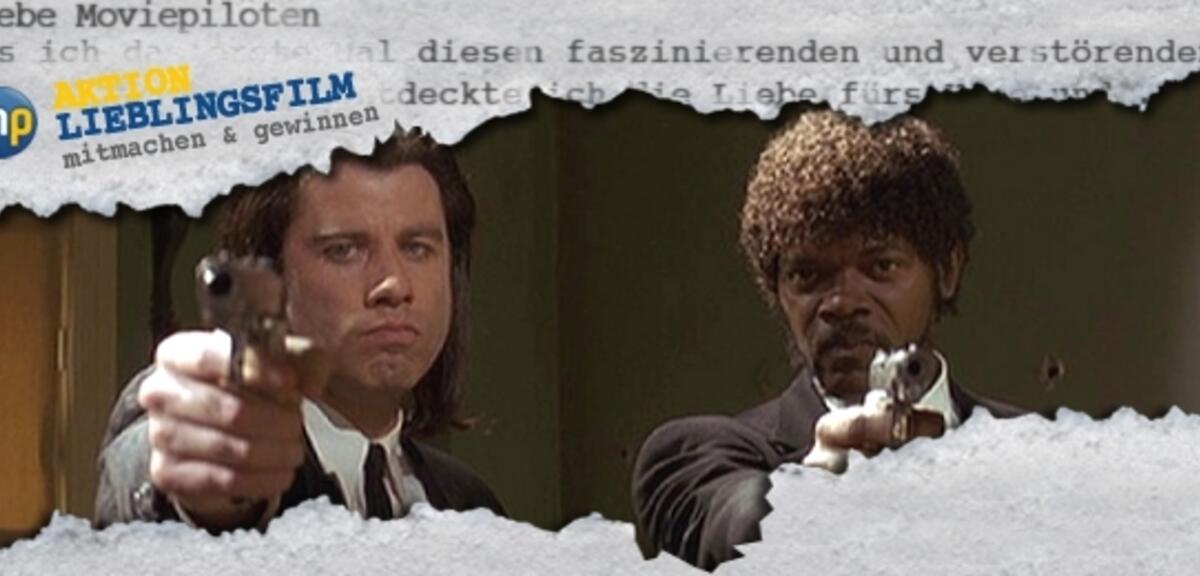„Oh man, ich hab Marvin ins Gesicht geschossen“, klagt John Travolta blutverschmiert in einem fahrenden Wagen. Wenn man über eine solche Szene lachen kann, dann hat man es entweder mit einer bodenlosen Geschmacklosigkeit oder mit Quentin Tarantino zu tun. Bei Pulp Fiction ist zweiteres der Fall, auch wenn viele ersteres genauso zutreffend finden. Denn wieder einmal spielt der „König der Grindhouse-Filme“ perfekt mit seinem Lieblingsmotiv, der Gewalt, und reizt dabei die Grenze des Ertragbaren komplett aus. Er bedient sich massenhaft Klischees und zieht seine absurden Übertreibungen 148 Minuten lang durch.
Während Pulp Fiction (zu deutsch etwa: Schundliteratur) also für viele deutlich zu weit geht, sieht der Filmkenner ein Meisterwerk, das jetzt schon Kult ist und sich in allen Belangen vom „Mainstream-Kino“ abhebt.
Schon bei der Erstellung der Charaktere bedient sich Tarantino aller Klischees, die er nur auftreiben konnte. Bei der Umsetzung kann er sich dabei voll auf das Schauspieltalent von John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis und Co. verlassen, die die maßlos übertriebenen Rollen nicht nur verdammt cool und locker spielen, sondern trotz massenhaft Gewalt und Schandtaten auch sympathisch erscheinen lassen.
Auch die Erzählstruktur weicht völlig von normalen Filmen ab. Rückblicke sind heutzutage nichts seltenes mehr, doch Pulp Fiction besteht aus drei Episoden, die alle miteinander verwoben sind und in nicht-chronologischer Reihenfolge erzählt werden. Erst am Ende des Film wird die Chronologie aufgelöst und lässt sich auch nur an beständigen Elementen wie z.B. dem Koffer oder der Kleidung der Protagonisten erkennen.
Was sich jedoch im Film, Chronologie hin oder her, abspielt, ist einfach nur ganz großes Kino. Die Dialoge, speziell zwischen Travolta und Jackson, wirken so nebensächlich und oberflächlich und dennoch sind wir amüsiert und fasziniert zugleich, wenn der gute John in aller Beiläufigkeit erklärt, dass man in Holland einen „Quarter Pounder“ aufgrund des metrischen Systems „Royal mit Käse“ nennt.
Von der ersten Minute an befindet man sich mit Pulp Fiction in einer Klischeewelt, deren extreme Übertreibung uns zwar permanent klar macht, dass das so nicht sein kann, die Art und Weise, wie das ganze umgesetzt wird, uns aber dennoch jedes Mal aufs Neue fesselt. Dabei unterstützen die langen Sequenzen mit den skurrilen Dialogen, die clever gewählte Symbolik und die tolle Filmmusik diese Stimmung perfekt und vervollständigen die Scheinwelt, die so absurd und greifbar zugleich erscheint.
Spätestens als der geniale Charakterdarsteller Christopher Walken bei seinem Kurzauftritt einem kleinen Jungen die Goldene Uhr seines, im Vietnamkrieg gefallen, Vaters überreicht und ihm stolz erklärt, dieser habe sie jahrelang „am sichersten Platz der Welt, nämlich in seinem Arsch“ aufbewahrt, verspürt der Zuschauer das Bedürfnis, laut über den Unsinn, den er sich da gerade reinzieht, loszulachen. Doch im nächsten Moment ertappt er sich dabei, wie er beeindruckt ist. Beeindruckt davon, wie es der Regisseur schafft, ihn trotz aller Absurditäten noch vor der Leinwand zu fesseln und in dem Moment sieht man den zufrieden grinsenden Tarantino fast bildlich vor sich, stolz sein Ziel erreicht zu haben.
Nicht zuletzt dient natürlich auch Pulp Fiction als Medium für jede Menge Anspielungen, versteckte Hinweise und Interpretationsspielraum, so wie man es von Tarantino gewohnt ist. So drückt er seinen angeblichen „Fußfetischismus“ zuerst in einer absurden Diskussion über Fußmassagen und später in einer beinahe minutenlangen Einstellung von Uma Thurmans nackten Füßen aus.
Ein weiteres Beispiel für die beinahe grenzenlose Symbolik im Film ist John Travoltas gestörtes Verhältnis zu Bedürfnisanstalten. Nicht weniger als fünfmal kommt er nämlich in Schwierigkeiten weil oder während er auf dem Klo sitzt und zuletzt kostet ihn der Gang zum stillen Örtchen dann sogar das Leben.
Doch das wohl spannendste Rätsel spinnt sich um den Koffer, um den sich eigentlich die komplette Handlung dreht. Sein Inhalt wird für den Zuschauer nie sichtbar und es wird ebenso wenig erwähnt, was sich darin befindet. Doch durch eine verzwickte Symbolik liefert uns Tarantino einen möglichen Interpretationsansatz: Gleich zu Beginn des Films zeigt er nämlich in einer bewussten Großaufnahme den Hinterkopf von Gangsterboss Marcellus Wallace, der ein großes Pflaster auf dem Nacken kleben hat. Mehr als nur ein Wink mit dem Zaunpfahl, denn laut Bibel entzieht der Teufel den Menschen ihre Seele durch den Nacken. In dem Koffer, der dazu noch den Code „666“ hat, befindet sich also vermutlich die Seele von Marcellus Wallace persönlich. Die Tatsache, dass Schauspieler Ving Rhames an der besagten Stelle tatsächlich eine Narbe hat, heizt die Spekulationen zusätzlich an und dürfte Tarantino wohl zu der Idee inspiriert haben.
Freilich also nichts für schwache und humorlose Gemüter, doch wer bereit ist, sich für filmisches Neuland zu öffnen und sich auf das Niveau von Pulp Fiction herab oder hinauf (das bleibt jedem selbst überlassen) zu begeben, der sollte sich diesen Kultstreifen nicht entgehen lassen. Denn ich bin sicher, dass man auch in zwanzig Jahren noch von diesem Film reden wird, von Tarantinos neuem, eigens kreierten Genre, dem der „klischeehaften Schundliteratur“…
Sollte der Text euer Gefallen finden und ihr möchtet ihn gern in der weiteren Auswahl für die Jury sehen, dann drückt bitte auf den Button “News gefällt mir” unter diesem Text. Wir zählen am Ende der Aktion Lieblingsfilm alle moviepilot-Likes zusammen.