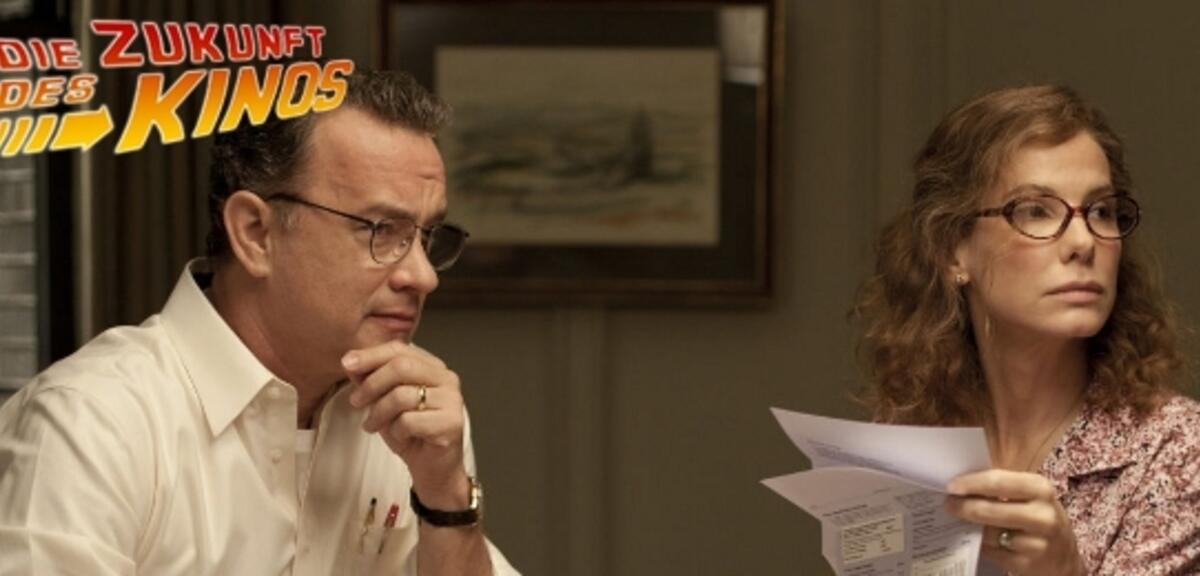Es gibt Tausende von ihnen auf der ganzen Welt und allein in Europa mehr als das Jahr an Tagen hat. Die Rede ist von Filmfestivals. Es gibt sie in groß und klein, in Glamour und Schraddel. Es gibt ein 9/11-Festival, ein Terrorfestival und sogar ein Fahrradfilmfestival. Warum? Die Liebe zum Film dürfte jedenfalls nicht der einzige Grund für den Boom der Festivals seit den 90er Jahren sein. Es ist schließlich kein Zufall, dass sowohl Die Simpsons, als auch South Park ganze Folgen der Parodie des Festivalwahns gewidmet haben. In Deutschland hat gefühlt jedes Kaff mit mehr als zehn Einwohnern und dem Wunsch nach mehr Touristen ein eigenes Filmfestival, was an sich ja nicht zu verurteilen ist. Das Idealbild des Festivals als Altar der Kinoliebe hat trotzdem nichts mit der Realität zu tun.
Lange Einstellungen und ein gepflegtes Gähnen
Seit Donnerstag tobt in der deutschen Hauptstadt die Berlinale und wie es der Zufall will, wird dort der Film The Woman in the Septic Tank gezeigt. Ganz trist geht der philippinische Streifen los mit Schwenks über das Elend in den Slums von Manila und unerträglich langen Einstellungen alltäglicher Handlungen. Dann der radikale Schnitt und plötzlich sehen wir Regisseur und Produzent des soeben gesehenen bzw. geplanten Streifens. Sie wollen ihren Film unbedingt bei den Festivals in Cannes, Berlin oder Venedig unterbringen. Also muss es richtig hart und sozialkritisch in ihrem Werk zugehen. Denn die Festivals lieben sowas. Dass The Woman in the Septic Tank (Was für ein Titel!) ausgerechnet bei der Berlinale gezeigt wird, hat schon eine feine Ironie. Denn von den drei Großen “A”-Festivals ist die Berlinale das politischste bzw. das Festival, das gern das politischste wäre. Dies regt die Kritiker oft genug auf, stellt die Auswahl doch regelmäßig politische Inhalte über die ästhetische Qualität der Beiträge, was schlussendlich zu gepflegter Langeweile führt. Für Produzenten und Filmemacher kann so ein Image dagegen eine Erleichterung bei der Produktion darstellen. Sie können planen, welche Zutaten sie brauchen, um ins Programm der Internationalen Filmfestspiele Berlin zu kommen.
Diese Berechnung wird nicht nur durch die Berlinale gefördert. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das ominöse Genre der Festivalfilme entwickelt, die mit einem kleinen Vorrat formaler Gestaltungsweisen arbeiten, der Spuren des europäischen Autorenfilms der 60er Jahre beeinhaltet. Sie nehmen semi-dokumentarisch soziale Problemfelder in Angriff und machen das gern mit laienhaft agierenden Darstellern. Sie sind nicht immer schlecht, aber nach dem Besuch von mehreren Festivals kann einem schon mal ein unangenehmer Déja-vu-Effekt beschleichen. Diese Streifen werden, wie andere auch, nur für die Verwertung im Filmfestivalzirkus hergestellt. Sie spekulieren auf die Vorlieben der Programmplaner und Festivalleitung genau wie die beiden Filmemacher es in The Woman in the Septic Tank getan haben. Diese Spekulation hat Methode und die Festivals fördern sie.
Eine kapitalistische Unterwelt
Während die Medienberichterstattung sich vielfach auf die großen Stars konzentriert, läuft bei den größeren Festivals, von Toronto über Berlin und Cannes bis hin nach Busan in Südkorea, ein ganz anderes, eigentlich viel spannenderes Spiel ab. Die Berlinale beherbergt den European Film Market, bei dem Verleihrechte und Lizenzgeschäfte für die TV- und Kinoverwertung getätigt werden. Anderswo rennen die Akquisiteure von Festival zu Festival, um neue Filme an Land zu ziehen. In Cannes, Berlin, Busan, Hongkong, Toronto und Co. wird das Festival zum Markt, auf dem gefeilscht und überboten wird. Wurde früher das beste Vieh verhökert, sind es heute Filmrechte, die da im großen Stil Besitzer wechseln. Das reicht von größeren Genre-Produktionen wie Machete Kills hin zu anspruchsvollen Werken, die durch ihre Teilnahme im Wettbewerb Akquisiteure auf sich Aufmerksam machen. Jüngstes Beispiel ist The Artist, der in Cannes für Furore sorgte, damit die Weinstein Company auf den Plan rief und den Rest der Geschichte dürftet ihr kennen.
Wie der Filmwissenschaftler Thomas Elsaesser hervorgehoben hat, entwickelte sich der Festivalzirkus in den vergangenen Jahren zu einer regelrechten Industrie, einer Art Gegenprogramm zur Traumfabrik und doch mit ihr eng verbunden. Denn mit Special Presentations und Platzierungen außerhalb des Wettbewerbs erhalten Blockbuster zusätzlich Aufmerksamkeit, während die Festivals durch die Stars für Furore sorgen. Mit Fonds finanzieren Festivals wie die Berlinale und Rotterdam mittlerweile sogar selbst Filme, so dass sie ihren eigenen Verwertungskreislauf immer schön mit neuem Material speisen. Denn bekommt ein Film durch die Aufnahme in eine Festivalsektion das Siegel “Cannes” oder “Venedig”, dann ist dieses laut Elsaesser vergleichbar mit den protzenden Studiologos des klassischen Hollywoodkinos. Statt Warner oder MGM heißt es nun Venezia oder Berlin. Oftmals bekommen die kleineren Filme nur mit diesem Siegel überhaupt eine Chance auf eine Kinoauswertung und die Festivals wissen um ihre Macht genauso wie die Studios. Dass darunter die thematische wie formale Vielfalt der Beiträge leidet, bekommen vor allem die Zuschauer zu spüren.
So bilden die Filmfestivals knallharte Arenen, in denen mit ein paar Vorführungen über Erfolg und Misserfolg eines Werks entschieden wird, also darüber, ob es überhaupt die Chance erhält, Zuschauer für sich zu gewinnen oder gleich in der Versenkung verschwindet. Filmfestivals sind damit längst nicht das idealisierte Paradies der Cineasten, als welches sie Besucher gern wahrnehmen. Mit dem Boom hat sich eine filmische Subkultur entwickelt, eine Art Hollywood des Arthouse-Films, die auf der ganzen Welt vernetzt ist; mit eigenen (inoffiziellen) Gerstaltungsvorgaben, eigener Produktion und eigener Verwertung. Im großen Stil sind Festivals also ein Industrie wie jede andere und die Berlinale ist eine ihrer Fabriken.